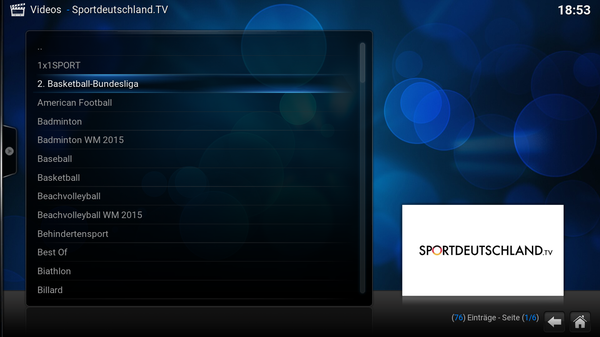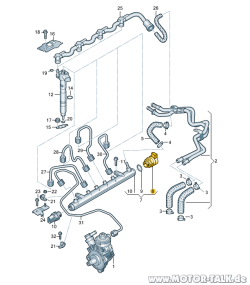Acht Wochen Ausnahmezustand, Aufregung und Außentrubel – der Zenit der Positivperiode scheint nun überschritten zu sein.
Es war ein schleichender Übergang, und wäre diese vergleichsweise lange, gute Phase ein Psychopharmakon gewesen, was sie, wie ich glaube, nicht war, würde ich sagen: es wurde sukzessive ausgeschlichen.
Frisch drogenfrei ist das Leben jetzt wieder das, was es üblicherweise ist: ein Knäuel aus Alltagsfäden, mal bunter, mal eintöniger, mal flauschiger, mal rauer, mal lockerer, mal verknoteter, mal besser strickbar, mal schlechter.
Aber eben ein Knäuel.
Ich weiß noch, wie ich mit Anfang 30 über die außerbüroliche, alltägliche Tretmühle dachte: immer hinterher sein, immer alles auf Stand halten, nichts aufschieben, nichts ausblenden, immer die Fäden in der Hand behalten und zwar möglichst wohlgeordnet, so dass jeder Faden noch einzeln als ein solcher identifizierbar bliebe, sich nichts nachhaltig verheddern könne – so dachte ich, würde Alltag funktionieren und sich elegant abwickeln lassen und das wiederum würde dann den Blick und den Terminkalender freigeben fürs Wesentliche.
Ein Konzept, das nicht hingehauen hat, weil a) der Alltag ein ständig sprudelnder, manchmal sogar über die Ufer tretender Fluss ist und b) das mit dem Wesentlichen ein krudes Konstrukt ist, das keinesfalls durch bloßes Draufblicken oder Zeithaben als ein solches entlarvt wird, da muss man schon richtig hindenken wollen und können (nebenbei: ganz ähnlich verhält es sich mit dem Gesuche nach dem „wahren Ich“ oder anderen heilsversprechenden Sinnskulpturen, die ja so unbedingt freigelegt werden sollten, wozu es eine Menge Beharrlichkeit und das handwerkliche Geschick eines Steinmetzes braucht – leider scheitert’s häufig gar nicht mal an mangelnder Konsequenz beim Gehämmere, sondern am zu bearbeitenden Material).
Meine Einstellung zum Alltag und mein Umgang mit diesem vielgesichtigen Genossen haben sich seither grundlegend gewandelt: man wird ihn nicht los, man bezwingt ihn auch nie so, dass er mal gar keine Rolle spielen würde, er ist allgegenwärtig und fährt auch nie in Urlaub, vermutlich geht er auch niemals in den Ruhestand.
Dieser Kerl hockt immerzu mit einer Bräsigkeit auf der Couch, sein Atmen ist permanent hörbar, außer nächtens, denn er legt sich meist zeitgleich mit seiner Dienerschar schlafen, allerdings schnarcht er manchmal hörbar. Ich hasse ihn nicht, ich habe ihn als Mitbewohner akzeptiert, aber die Dompteusenallüren, die ich ihm gegenüber früher hatte, die habe ich ad acta gelegt.
Die Woche beginnt also mit einem stattlichen Alltagspaket, die Freibadflucht wird vom Wetter vereitelt, beim Quicheteig-Ausrollen höre ich ein Feature über die Europapolitik der AfD und muss mit leicht fettigen Fingern den Sender wechseln, was ich üblicherweise nicht tue, doch diesmal ist die Sorge, dieser thematische Dreck könne in meinen schönen, glatten Quark-Öl-Teig eindringen, größer als mein Widerwille, einen kleinen Fettabdruck auf einem Drehknopf zu hinterlassen.
Mittags um 12 Uhr stelle ich dem Gatten und mir ein Mango-Kokos-Müsli hin und fahre das Laptop hoch.
Im Maileingang erfreut mich ein weiteres Angebot zu meiner annoncierten Alltagsflucht (oder soll ich es Auszeit nennen? nein, Auszeit kann ich nicht mehr hören, das ist dieselbe Kategorie wie Kraftort und Seelennahrung – angesagtes Aufbauschvokabular, dem ich möglichst oft eine Absage erteilen möchte).
Zwischenzeitlich habe ich vier Wohn-Offerten (eine Resonanz auf meinen letzten Blogbeitrag, mit der nicht zu rechnen war) erhalten, von denen sich vermutlich zwei realisieren lassen – das wäre der Wahnsinn.
Das Fräulein und ich in Schreibklausur, unglaublich, womöglich ließe sich so bis Ende Oktober das selbstgesteckte Ziel erreichen (nein, konkreter wird’s hier nicht).
Einer der beiden Solituden-Orte ist unter dem Aspekt der Arbeitsförderlichkeit ein bisschen heikel: er ist dermaßen schön und zudem mit intensiven Erinnerungen an eine Zeit verbunden, in der Themen wie berufliche Endstationen, drohende Altersarmut, ernsthafte Krankheiten oder plötzliche Tode noch Dinge waren, die nichts mit dem eigenen Lebenskreis zu tun hatten – das waren Phänomene, die andere betrafen, die unjünger, ungeschickter, unglücklicher oder unklüger waren. Spätadoleszente Arroganz und Ignoranz muss das gewesen sein, dennoch peinlich.
Wahrscheinlich denken viele, die jung sind, dass „es“ einen selbst schon nicht treffen wird (und „es“ ist ja nur die Überschrift für ein Potpourri aus Pleiten, Pech und Pein) und dieser Zustand währt genau so lange, bis man mit der Niederlage konfrontiert wird: dem Ergebnis der eigenen Erfolglosigkeit, fehlender Lebensplanung, mangelnder Weitsicht, falsch abgebogen hier, falsch eingeparkt dort, zu faul, um zu wenden oder die Spur zu wechseln, zu optimistisch oder zu blauäugig, um das als Fehler oder Faulheit zu begreifen.
Bis man das eigene partielle (oder fundamentale) Scheitern in einer Gesellschaft erkennt, die auf (Erfolgs-)Maximierung setzt anstatt auf Reduzierung, schleppt man bereits so viel Ballast mit sich, dass es anschließend ein ziemliches zähes Unterfangen ist, sich ein Leben im Kleinen und Überschaubaren zuzutrauen und einzurichten.
Ich war jung, als ich erstmals an diesen schönen Ort in Österreich reiste, ich saß mit einer Zigarette im Mund auf dem Sims eines Dachfensters und spähte wahlweise hinüber zu dem Haus des Schauspielers, den ich verehrte, oder zu dem See hinunter, in dem ich jeden Abend schwamm, nicht mal die Mücken konnten mir damals etwas anhaben.
Nach dem Schwimmen lief ich mit nassen Haaren zurück zu dem billigen Gasthof, in dem ich mich eingemietet hatte, trocknete mich gründlich ab, schlüpfte in mein Nachtgewand und erklomm erneut meinen Beobachterposten. Ich blies Rauchkringel in den Nachthimmel, bis drüben im Schauspielerhaus das Licht erlosch und drunten am See die noble Gästeschar von der Terrasse in ihre teuren Gemächer schwappte, blieb im geöffneten Fenster sitzen, bis rundum alles dunkel war, erst dann sprang ich hinab von meinem Hochsitz, setzte mich an den kleinen Tisch und schrieb meine Notizbücher voll, ein Laptop besaß man damals noch nicht.
Tagsüber las ich, ging Spazieren, kaufte mir im Dorfladen etwas zu Essen und zu Trinken und stieg einmal auf den Hausberg, um mir oben auf der Hütte einen Kaiserschmarrn zu gönnen, als Highlight der Woche.
Daheim wartete nichts und niemand, weder Alltagsdinge noch Post stapelten sich dort, die drei Pflanzen waren robust genug, um eine Woche allein zu überleben, es herrschte ein innerer und äußerer Behausungszustand, in dem es noch möglich war, ohne einen organisatorischen Vorlauf von mehreren Tagen einfach zu verschwinden.
Ab und an telefonierte ich vom Zimmertelefon aus, das sich – weil noch fest mit einer Buchse in der Wand verbunden – leider nicht mit auf den Fenstersims nehmen ließ, mit jemanden, in den ich ein bisschen verliebt war, doch damals dauerten Telefonate aus dem Ausland nur dann länger, wenn man entweder genug Geld hatte oder sehr verliebt war, beides traf in jenem Sommer auf mich nicht zu.
Zwei weitere Male besuchte ich diesen Ort noch, zuletzt vor drei Jahren, jedesmal begegnete ich meinem Erstaufenthaltsgefühl wieder, wie ein Schatten meiner damaligen Unversehrt- und Unbeschwertheit huschte es auf dem östlichen Seeuferweg an mir vorbei, streifte mich dabei an der nackten Schulter und schien mir im Überholen zuzurufen, ich solle doch einfach mitkommen, ins Ungewisse, ins Dickicht, ins wilde Gelände unterhalb der felsigen Steinwand, die hinter dem See aufragt.
Das Fräulein war der Ansicht, wir sollten nicht lange fackeln und dem Aufruf folgen, aber mein persönliches Abenteuerpotenzial war absurd fest an die Ablaufzeit eines Parktickets getackert, das auf der anderen Seeseite hinter einer kochend heißen Windschutzscheibe seiner püntklichen Entfernung entgegenschmorte – wir hatten nur drei Stunden Zeit, dann mussten wir weiter. Man ist definitiv nicht mehr jung, wenn man von einem Parkschein den perforierten Seitenstreifen abtrennt, diesen ordentlich in die Handyschutzhülle steckt, wo er einem dann bei jedem Fotografiervorhaben anglotzt und ermahnt, bitteschön stets die Zeit im Blick zu behalten.
Auch jetzt gilt es, die Zeit im Blick zu behalten.
Die Gemüsefüllung für die Quiche muss noch gewürzt und in die bereits mit Teig ausgekleidete Form gegossen werden, damit nach der Gassirunde nur noch der Ofen seine Arbeit tun muss.
Bei der Küchenarbeit höre ich übrigens nicht nur Radiosendungen zum Abschalten, sondern auch welche zum Dranbleiben, wie zum Beispiel diese hier, die wie die Faust aufs Auge bzw. das Nudelholz auf den Teig zum Werkeln am Herd passt.
Kleiner Tipp vorab, falls Sie sich die Sendung anhören möchten: Ignorieren Sie unbedingt die Stimme der Wissenschaftlerin sowie ihre permanenten Griffe in den Phrasenpott („tatsächlich“ / „am Ende des Tages“ usw.), man fühlt sich zum Mitzählen animiert – tun Sie’s nicht, sondern fokussieren Sie sich auf den Inhalt.
Wenn Ihnen nicht nach Hören, sondern nach Weiterlesen ist, und dies auch garantiert phrasenphrei, dann empfehle ich wie immer an dieser Stelle den Montagsmittagbeitrag aus dem geschätzten Hause Graugans.